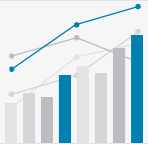rund 25 Jahre ist es her, dass die europäische Stahlindustrie nach den Boomjahren des Wiederaufbaus von einer existenziellen Krise erschüttert wurde. Politisch dominierte Eigentümerstrukturen, der Glaube an grenzenloses Wachstum und das Ignorieren von Grundprinzipien der Marktwirtschaft zugunsten eines zunehmend durch Protektionismus und Subventionen geprägten Staatsdirigismus führten letztlich dazu, dass sich immer mehr Länder „ihre“ durch enorme Überkapazitäten geprägte Stahlindustrie nicht mehr leisten konnten. Was folgte, waren Werksschließungen verbunden mit Demonstrationen, Streiks und wilden Auseinandersetzungen zwischen Politik, Gewerkschaften, Belegschaften und Unternehmensleitungen sowie schließlich als letzte Konsequenz der grundsätzliche Paradigmenwechsel – Privatisierung und Konsolidierung. Aus einer durch Staatseigentum geprägten Industrie wurden börsennotierte oder privat geführte Konzerne, von rund 30 größeren Stahlunternehmen noch zu Beginn der 1990er-Jahre sind heute in der Europäischen Union weniger als zehn mehr oder weniger große Unternehmensgruppen verblieben.
Man müsste meinen vorbildlich – eine Entwicklung wie aus dem Lehrbuch für Betriebswirtschaft: Die europäische Stahlindustrie und mit ihr die Politik haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. – Weit gefehlt! Was ist tatsächlich passiert? Nach den – letztlich überschaubar gebliebenen – Strukturanpassungsmaßnahmen der 1990er-Jahre setzte kurz nach den Ereignissen von „9/11“ ein vor allem vom wirtschaftlichen Erwachen Chinas getriebener weltweiter ökonomischer Aufschwung mit einer bis dahin in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte noch nicht dagewesenen Dynamik ein, der erst mit den Vorgängen um „Lehman“ im September 2008 ein jähes Ende fand. Der globale, alle wesentlichen Industriebereiche erfassende Nachfrageboom deckte über Jahre die nach wie vor bestehenden gravierenden strukturellen Schwächen der europäischen Stahlindustrie zu – ja er verstärkte sie insofern sogar noch, als viele Unternehmen der Versuchung des schnellen Geldes durch eine Erweiterung ihrer Kapazitäten im Massenstahlbereich nicht widerstehen konnten und damit zu einer zusätzlichen Verschärfung der Kapazitätsproblematik beitrugen.
Die nunmehr seit bald fünf Jahren anhaltende Staatsschulden-, Finanz- und Wirtschaftskrise, unter der Europa stärker als alle anderen Wirtschaftsregionen dieser Welt leidet, beschert der Stahlindustrie mehr als nur ein leidvolles Déjà-vu der 80er- und 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts: Denn nicht nur, dass Staatsinterventionismus, Arbeitskampf sowie Protektionismus und Subventionsüberlegungen die aktuelle Diskussion wieder anheizen, ist die überwiegend unter immer stärkerem finanziellem Substanzverlust leidende Industrie zunehmend weniger in der Lage, sich die zur Erhaltung der globalen Konkurrenzfähigkeit erforderlichen Investitionen in zukunftsorientierte Technologien und Qualität zu leisten. Die europäische Stahlindustrie ist vor diesem Hintergrund gerade dabei, ihre jahrhundertelange technologische Vorherrschaft zu verlieren.
Nicht zu leugnendes Faktum am Lauf der Dinge ist, dass jedes Produkt, jeder Prozess einem mehr oder weniger langen Lebenszyklus unterliegt und damit irgendwann an sein Ende kommt. Das gilt auch für Stahlprodukte, Stahlerzeugungsverfahren und Stahlstandorte. Wenn Produkte, Verfahren und Standorte, gleich in welchem Industriebereich, nicht einer permanenten Erneuerung unterzogen werden – und dies stößt aufgrund härter werdenden Wettbewerbs und damit immer häufiger limitierter finanzieller Mittel naturgemäß an Grenzen –, ergibt sich für sie ein Ablaufdatum – und je kompetitiver eine Branche, je beschränkter die Nachfrage, umso klarer wird dieses Datum im Einzelfall erkennbar.
Manche gesellschaftliche und politische Gruppierungen tendieren heute – auch als Reaktion auf kritische, da nur am ultimativen monetären Nutzen orientierte Entwicklungen der letzten Jahrzehnte – dazu, diesen ökonomischen Kreislauf außer Kraft setzen zu wollen. Das heißt, nicht mehr konkurrenzfähige Produktionsstandorte unter allen Umständen erhalten zu wollen – sei es durch politischen Druck auf Eigentümer und Management, Subventionen, protektionistische Maßnahmen oder letztlich Verstaatlichung –, und bedeutet damit nichts anderes, als die Grundgesetze von Angebot und Nachfrage außer Kraft zu setzen. Die Erfahrungen des ersten derartigen Versuchs in den 1980er-Jahren lehren uns, dass dies schon insofern nicht funktioniert, als daraus letztlich zwangsläufig ein Subventionswettlauf entsteht, den sich Staaten auf Dauer nicht leisten können. Am Ende des Tages kommt es damit erst recht zu den dann überfälligen Strukturbereinigungen, allerdings in nur noch größeren Dimensionen, mit noch schmerzvolleren sozialen Härten und zu noch höheren Kosten, da durch das künstliche Erhalten unrentabler Unternehmen mit zunehmender Dauer auch gesunde in ihrer Existenz in Frage gestellt werden. Für die betroffenen Menschen stellt diese Vorgangsweise alles andere als einen fairen Weg dar, da sie in einer letztlich trügerischen Hoffnung auf einen sicheren Arbeitsplatz gehalten werden. Menschlich fairer und gleichzeitig ökonomisch sinnvoller wäre es, ihnen rechtzeitig und offen die Fakten darzulegen und ihnen damit – solange noch ausreichend Mittel vorhanden sind – eine fundierte berufliche Um- oder Neuorientierung zu ermöglichen. Aber eine solche Vorgangsweise würde gleichermaßen Mut und Ehrlichkeit voraussetzen, heute bei vielen Entscheidungsträgern nicht wirklich herausragende Eigenschaften. Probleme aufzuschieben, „wegzudiskutieren“, zu versuchen, sie „auszusitzen“, funktioniert in einer globalisierten und extrem dynamisch gewordenen Wirtschaftswelt nicht mehr. Wer aussitzt, wird von den Konkurrenten überrollt – genau das droht heute der europäischen Stahlindustrie.
Einmal mehr bleibt uns damit in Bezug auf unser Unternehmen nur die Feststellung, dass sich der Weg weg vom klassischen Stahlunternehmen hin zum stahlbasierten Technologie- und Industriegüterkonzern im Hochqualitätsbereich als richtige Alternative zu einer immer noch in Millionen Tonnen denkenden Industrie erwiesen hat. – Und auf eines können Sie sich verlassen: Wir werden diesen Weg mit größter Konsequenz weiter fortsetzen. Die Basis dafür haben wir gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat in Form des Konzepts „Strategie 2020“ gelegt, für die nächsten zehn Jahre – und darüber hinaus.
Linz, 27. Mai 2013
Der Vorstand
|
Wolfgang |
Herbert |
Franz |
Robert |
Franz |